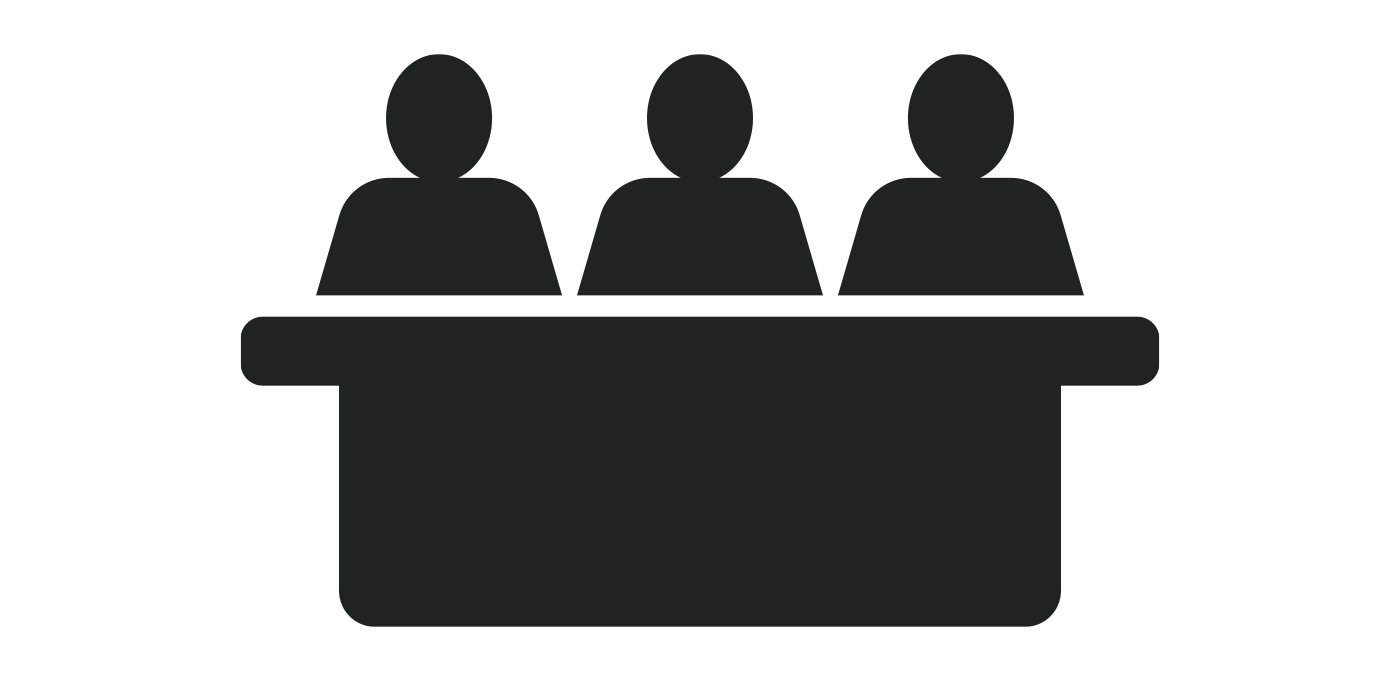
Höhere Hürden für die Anfechtung von Zahlungen vor der Insolvenz
Ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs* sorgt für mehr Sicherheit für Geschäftspartner insolvent gewordener Unternehmen. Verwalter insolventer Unternehmen können Zahlungen der letzten 10 Jahre nun nur noch unter schwereren Bedingungen zurückfordern. Allein die Zahlungsunfähigkeit zum Zeitpunkt der Zahlung reicht nicht aus, um rückwirkend die konkrete Zahlung anzufechten. Stattdessen muss der Schuldner den Gläubigern bewusst Schaden zugefügt haben, um einen Benachteiligungsvorsatz des Schuldners gegenüber den Gläubigern anzunehmen. Erst dann ist die Anfechtung der Zahlung möglich. Vorsatz besteht zum Beispiel, wenn für den Schuldner keine realistische Aussicht bestand, dass seine Gläubiger noch vollständig ihr Geld zurückerhalten würden.
Hintergrund: Vorsatzanfechtung
Die Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO ist ein Werkzeug, mit dem Insolvenzverwalter unter bestimmten Bedingungen Zahlungen zurückfordern können, die bis zu zehn Jahre vor einer Insolvenz geleistet wurden. Das neue Urteil des Bundesgerichtshofs macht deutlich, wie genau diese Nachweise geführt werden müssen.Die Vorsatzanfechtung erlaubt es, Zahlungen oder Handlungen eines Unternehmens anzufechten, wenn diese mit dem Ziel vorgenommen wurden, andere Gläubiger zu benachteiligen. Dazu muss der Insolvenzverwalter zwei Dinge nachweisen:
- 1. Der Schuldner hat gewusst oder in Kauf genommen, dass andere Gläubiger benachteiligt werden.
- 2. Der Empfänger der Zahlung wusste davon oder hätte es wissen müssen.
Das Ziel ist es, diese Zahlungen wieder in die Insolvenzmasse zu holen, damit alle Gläubiger gleichbehandelt werden.
Die „neue“ Rechtsprechung kann freilich nur dann berücksichtigt werden, wenn der Anfechtungsgegner eine Gegenleistung erhalten hat, auf die er in der Art und zu der Zeit einen Anspruch hatte, wenn also kongruente Leistungen vorlagen.
Was bringt das neue Urteil?
Das Urteil präzisiert, wie der Insolvenzverwalter die genannten Voraussetzungen beweisen muss:1. Strengere Anforderungen an den Nachweis:
Der Insolvenzverwalter muss konkrete Hinweise darauf geben, dass der Schuldner bei der Zahlung wusste, dass andere Gläubiger benachteiligt werden.2. Deckungslücke als wichtiger Hinweis:
Eine sogenannte Deckungslücke liegt vor, wenn ein Unternehmen mehr Schulden hat, als es begleichen kann. Diese Lücke muss so groß sein, dass selbst optimistische Annahmen keine vollständige Rückzahlung an die Gläubiger erwarten lassen.3. Sanierungsversuche:
Der Verwalter muss beweisen, dass keine realistische Chance bestand, das Unternehmen wieder wirtschaftlich stabil zu machen, und dass der Schuldner dies wusste.Was heißt das für Insolvenzverwalter?
Das Urteil macht die Aufgabe für Insolvenzverwalter anspruchsvoller. Sie müssen:- Liquiditätsübersichten erstellen: Eine klare Darstellung der finanziellen Lage des Unternehmens zum Zeitpunkt der Zahlung ist notwendig.
- Beweise sammeln: Dazu gehören Dokumente, Aussagen von Mitarbeitenden und Nachweise über mögliche Investoren oder Aufträge.
- Den gesamten Fall betrachten: Einzelne Hinweise reichen nicht aus – der gesamte Kontext muss betrachtet werden.
Was bedeutet das für Gläubiger?
Gläubiger, die eine Rückforderung erhalten, haben durch das Urteil neue Möglichkeiten, sich zu wehren:- Nachweise prüfen: Oft können sie argumentieren, dass der Insolvenzverwalter die hohen Anforderungen des BGH nicht erfüllt hat.
- Vergleichsmöglichkeiten: Aufgrund der strengeren Regeln kann es sinnvoll sein, eine geringere Rückzahlung auszuhandeln.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Urteils
- Hinweise auf Benachteiligung: Der Insolvenzverwalter muss zeigen, dass der Schuldner bewusst gehandelt hat.
- Finanzielle Lage: Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens muss so schlecht gewesen sein, dass klar war, dass nicht alle Gläubiger ihr Geld bekommen werden.
- Sanierungsaussichten: Es muss bewiesen werden, dass eine Rettung des Unternehmens ausgeschlossen war.
Fazit
Das neue Urteil macht die Vorsatzanfechtung schwieriger für Insolvenzverwalter und eröffnet neue Verteidigungsmöglichkeiten. Es lohnt sich, Forderungen genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Unterstützung zu suchen. In vielen Fällen kann eine gute Verhandlungsstrategie helfen, die Rückforderung zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden.Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, wenn Sie ein Schreiben von Insolvenzverwaltern erhalten haben, in dem Zahlungen an Sie bzw. Ihr Unternehmen angefochten werden.
Glossar – alle Fachbegriffe des Blogbeitrags einfach erklärt:
Ihre Ansprechpartner bei DMR:

Dr. Maximilian Degenhart
- M: maximilian.degenhart@dmr.legal
- T: +49 (0) 89 215 273 96
- F: +49 (0) 89 380 348 19
- W: www.dmr.legal
Glossar – alle Fachbegriffe des Blogbeitrags einfach erklärt:
Vorsatzanfechtung:
Das rechtliche Mittel, um Zahlungen zurückzufordern, die mit der Absicht erfolgt sind, Gläubiger zu benachteiligen.Gläubigerbenachteiligung:
Eine Situation, in der ein Gläubiger schlechter gestellt wird als andere. Dies kann strafrechtlich relevant werden, wenn der Geschäftsführer einer Gesellschaft bewusst Zahlungen so steuert, dass andere Gläubiger absichtlich benachteiligt werden. Nach § 283c StGB kann dies als Bankrott oder Insolvenzverschleppung geahndet werden. Geschäftsführer geraten in den Verdacht der Gläubigerbenachteiligung, wenn sie etwa nicht rechtzeitig Insolvenz anmelden oder bewusst Zahlungen an ausgewählte Gläubiger vornehmen, obwohl andere nicht mehr bedient werden können.Insolvenzmasse:
Das Vermögen eines insolventen Unternehmens, das zur Begleichung der Schulden verwendet wird.Deckungslücke:
Der Betrag, um den die Schulden eines Unternehmens seine verfügbaren Mittel übersteigen.Sanierungsversuch:
Der Versuch, ein wirtschaftlich angeschlagenes Unternehmen durch Maßnahmen wie Investitionen oder Umschuldung zu retten.Liquiditätsübersicht:
Eine Darstellung, die zeigt, welche finanziellen Mittel einem Unternehmen zur Verfügung stehen und welche Verpflichtungen es hat. Zur Prüfung der Zahlungsunfähigkeit werden verschiedene Zeiträume herangezogen:- 13-Wochen-Frist: Eine kurzfristige Betrachtung, die zeigt, ob das Unternehmen in den nächsten drei Monaten alle Zahlungen leisten kann.
- 24-Monats-Zeitraum: Eine langfristigere Analyse, die die nachhaltige Finanzierbarkeit von Verbindlichkeiten prüft.
- Tagesgenaue Liquiditätsplanung: Diese wird genutzt, um akute Zahlungsschwierigkeiten zu erkennen und dient oft als Grundlage für die Einschätzung der Zahlungsunfähigkeit.
- Diese Zeiträume helfen, rechtzeitig auf drohende Insolvenzen zu reagieren und die finanziellen Verhältnisse objektiv zu bewerten.
Vergleichsverhandlung:
Eine Einigung zwischen Gläubiger und Schuldner, bei der nur ein Teil der geforderten Summe zurückgezahlt wird.
Fußnote: *Urteil des BGH Az. IX ZR 239/22;
Erläuterung zum Sachverhalt:
Der Insolvenzverwalter einer Charter-GmbH (Schuldnerin) forderte im Rahmen einer Insolvenzanfechtung von der beklagten Bundesbehörde die Rückzahlung von 20 Einzelzahlungen über insgesamt 235.976,63 €, die zur Begleichung von Luftsicherheitsgebühren erfolgten. Die Schuldnerin hatte diese Zahlungen zwischen August und November 2014 an die Bundeskasse und das Hauptzollamt geleistet, teils nach Vollstreckungsandrohungen. Während das Landgericht alle Zahlungen für anfechtbar hielt, strebte die Beklagte mit ihrer Revision weiterhin die vollständige Abweisung der Klage an.
Die Leitsätze in Originalfassung:
- Leitsatz 1: Eine Deckungslücke, die mit hinreichender Gewissheit darauf schließen ließe, für den Schuldner habe keine begründete Aussicht bestanden, seine übrigen Gläubiger zukünftig vollständig befriedigen zu können, kann in der Regel nicht allein aus den zur Begründung einer Zahlungseinstellung herangezogenen Verbindlichkeiten des Schuldners abgeleitet werden.
- Leitsatz 2: Die Annahme der Zahlungseinstellung setzt die tatrichterliche Überzeugung voraus, der Schuldner habe aus Mangel an liquiden Mitteln nicht zahlen können; Zahlungsverzögerungen allein, auch wenn sie wiederholt auftreten, reichen für diese Überzeugung häufig nicht.
- Leitsatz 3a: Die Zurechnung des Wissens zwischen verschiedenen Behörden setzt eine tatsächliche Zusammenarbeit im konkreten Fall voraus; eine nur abstrakt unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehene Zusammenarbeit reicht nicht aus.
- Leitsatz 3b: Für die Zurechnung von außerhalb der konkreten Zusammenarbeit erworbenen Wissens bedarf es einer Einbindung des Wissensträgers, welche die Weitergabe auch dieses Wissens erwarten lässt.

